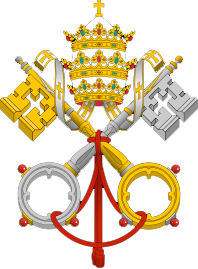Sie befinden sich hierChawah war nie im Garten Eden — oder: Das generische Maskulinum und die Schöpfungsordnung
Chawah war nie im Garten Eden — oder: Das generische Maskulinum und die Schöpfungsordnung
 25. Juni 2013
25. Juni 2013
Wie sich die Zeiten ändern: Vor zwei Jahrzehnten wurde Leipzig wegen seiner Bedeutung für die Beseitigung der SED-Herrschaft noch respektvoll als »Heldenstadt« apostrophiert, heute ist die Stadt wegen einer beispiellosen Provinzposse zum Gespött der Nation geworden. Schuld ist die hiesige Universität, die sich wohl auf ihre Vergangenheit als »Karl-Marx-Universität« besonnen hat und meint, ohne Not ein Revolutiönchen vom Zaune brechen zu müssen: Die Einführung des »generischen Femininums«.
Für diejenigen Leser, die Sprache einfach so benutzen, ohne sich groß Gedanken über deren grammatische Struktur zu machen, sei kurz erklärt, um was es geht: Es gibt im Deutschen das sogenannte »generische Maskulinum«, ein grammatisches Constuct, das auf Personengruppen unbekannten oder verschiedenen Geschlechts bezogen ist. Grammatisch ist es männlich, tatsächlich ist es unbestimmt: Wer von den Lehrern einer Schule spricht, meint damit eben alle Lehrer ungeachtet ihres physischen Geschlechtes, wer von den Studenten einer Universität redet, meint natürlich männliche und weibliche gleichermaßen. Das generische Maskulinum ist also eine geschlechtsneutrale Sammelbezeichnung, und da im Deutschen der Genus (das grammatische Geschlecht) ohnehin nicht in jedem Falle mit dem Sexus (dem biologischen Geschlecht) zusammenfällt — man denke nur an das Mädchen und die Mannschaft — hat auch die grammatische Verallgemeinerung, die das generische Maskulinum mit sich bringt, niemanden gestört, bis ca. in den Siebzigern des vorigen Jahrhunderts überspannte Kleingeister den Gedanken entwickelten, daß das generische Maskulinum diskriminierend sei, da bei all den Beamten, Wanderern, Brandstiftern, Mördern, Radfahrern und Brillenträgern die weiblichen jeweils nur »mitgemeint« seien, ohne aber ausdrücklich bezeichnet zu werden. Es wurde behauptet, das generische Maskulinum sei ein patriarchalisches Unterdrückungsinstrument zur Marginalisierung der Frau. Wie gesagt: Der deutsche Genus folgt nicht gerade den Regeln der Logik, es ist weder einsichtig, warum das Messer sächlich, die Gabel weiblich, der Löffel aber männlich sein soll, noch warum der grammatisch männliche Tisch ein sächliches Bein hat. Aber der Diskriminierungsvorwurf, so absurd er auch ist, ließ sich, einmal erhoben, nicht mehr aus der Welt schaffen, und ein großer Teil der Sprachgemeinschaft läßt sich seitdem von ein paar ideologisch verblendeten Feministen (beiderlei Geschlechts, natürlich) am Nasenring durch die Manege führen.
Der deutschen Sprache ist das nicht gut bekommen. Kaum ein Politiker wagt sich noch, die Bürger des Landes anzusprechen, umständlich werden »Bürgerinnen und Bürger« adressiert, wiewohl der Plural »Bürger« grammatisch korrekt bereits alle einschließt. Im Schriftverkehr hielt das regelwidrige, aber politisch korrekte[G] Binnen-I Einzug und bescherte uns »BürgerInnen«, wodurch Schriftsprache und gesprochene Sprache auseinanderfielen: Einen Text mit Binnen-I kann man nicht mehr einfach eins zu eins vorlesen, ohne daß er mißverständlich würde — was ein großer Rückschritt in der Sprachentwicklung ist. Weil die Geschlechterdoppelung umständlich und das Binnen-I häßlich und regelwidrig ist, verlegte man sich schließlich darauf, jegliche Geschlechtlichkeit durch Partizipconstructe zu umgehen: Man sprach plötzlich nicht mehr von Studenten, sondern von Studierenden, ungeachtet der Frage, ob bezeichnete Studenten denn tatsächlich gerade Studierende seien oder nicht möglicherweise im Moment Feiernde, Schlafende oder Essende. Man sprach nicht mehr von Teilnehmern, sondern von Teilnehmenden, nicht von Leitern, sondern von der Leitung, nicht von Lehrern, sondern von Lehrkräften. Ein Wiener Leitfaden für »Geschlechtergerechtes Formulieren« fordert allen Ernstes dazu auf, Sätze wie »Die Bewerber müssen einen Antrag ausfüllen.« zu ersetzen durch »Für die Bewerbung muss ein Antrag ausgefüllt werden.«
So weit, so schlecht. Nachdem sich — nach Jahrzehnten der experimentellen Operationen am offenen Herzen des deutschen Sprachcorpus — all diese Strategien zur Umschiffung des generischen Maskulinums als extrem sperrig und wenig praxisgängig herausgestellt hatten, wollte man natürlich nun nicht einfach zugeben, daß man sich hoffnungslos verrannt hatte und einfach wieder regelgerecht von Professoren, Studenten und Beamten reden und schreiben. Schon vor Jahren hatte deshalb die Feministin Frl. Prof. Pusch in ihrem Aufsatz »Das Deutsche als Männersprache. Diagnose und Therapievorschläge« vorgeschlagen, zur Unkenntlichmachung des Geschlechts die weiblichen Endungen -in und -innen abzuschaffen. Es solle dann heißen: die Professor, die Student etcetera.
Senat und Rektorat der Universität Leipzig haben nun aber beschlossen, in Schriftstücken statt der bisher verwendeten Schrägstrich-Variante (Professor/Professorin) ausschließlich die weibliche Form »Professorin« zu verwenden und in einer Fußnote darauf hinzuweisen, daß diese auch für männliche Collegen gelte. Damit ist das generische Femininum erschaffen und Deutschland biegt sich vor Lachen bei er Aussicht auf Anreden wie »Herr Professorin«, auch wenn die Universität dementiert, daß dies die zwangsläufige Folge des Beschlusses sein müsse. Wer sich dafür interessiert, findet weitere Kommentare zum Beispiel hier und hier, ich möchte derweil die Leipziger Farçe zum Anlaß nehmen, das viel interessantere generische Maskulinum der biblisch bezeugten Schöpfungsordnung zu referieren.
Beim Maskulinum der deutschen Grammatik haben wir es, wie oben erklärt, nur mit einer scheinbaren Inklusion des weiblichen Elements im männlichen zu tun — nur scheinbar deshalb, weil das grammatische Geschlecht ja mehr oder weniger zufällig ist und ohnehin keine zuverlässigen Rückschlüsse auf das biologische Geschlecht zuläßt, und immerhin bringt schon das die Feministen regelmäßig auf die Palme (und hat allein dadurch bereits eine ausreichende Daseinsberechtigung). Die Bibel aber wartet mit einem »generischen Maskulinum« auf, das nicht nur theoretisch-grammatischer, sondern faktischer, existentieller Natur ist. Ich rede von der Inklusion, die wir in der Schöpfungsordnung dargestellt finden: Es steht geschrieben: »Männlich und weiblich erschuf er sie und segnete sie und rief ihren Namen Adam im Tag ihres Erschaffenwerdens.« (1. M. 5, 2)*. Dies ist eine klar bezeugte Tatsache, und doch scheint sie weitgehend unbekannt zu sein. Unser Denken ist hier so geprägt von Kulturgeschichte und kirchlicher Lehrtradition, die uns immer wieder von Chawah (Eva) und der Frucht vom Baum der Erkenntnis erzählt haben, daß die Annahme, daß Adam und Eva gemeinsam Bewohner des Gartens Eden gewesen seien, unausrottbares Gemeingut geworden ist. Und doch sagt die Schrift etwas anderes: Im Garten lebten nicht Adam und Chawah, sondern Adam (männlich) und Adam (weiblich). Jahweh nannte beide Adam! Das war die notwendige Folge der Tatsache, daß das Weib ja aus dem Mann herausgeteilt worden war. Sie war im buchstäblichen Sinne seine »rechte Hand«, sie war gedacht und erschaffen als Adams zweite Leiblichkeit, ihm zu Hilfe und Gegenwart, eine Erweiterung seiner physischen Existenz, die es ihm erlaubte, seinen Wirkungsbereich im Garten Eden zu erweitern. Der gemeinsame Name bedeutet nicht, daß beide Teile gleich gewesen wären, sondern daß sie eine völlige Einheit bildeten. Erst mit dem Angebot der Schlange kam der weibliche Teil Adams auf diesen Selbstverwirklichungstrip, der zum Herauswurf aus dem Garten führte, und erst mit diesem Herauswurf bekam das Weib einen neuen Namen: »Und der Adam rief den Namen seiner Männin Chawah (Eva), denn sie, sie wurde die Mutter alles Lebenden.« (1. M. 3, 20)*.
Chawah war nie im Garten Eden, denn solange das Weib dort war, hieß es Adam. So wie im kommenden Königreich nur Platz ist für den Christos — und damit aber gleichzeitig auch für alle, die in ihn hineinversetzt sind und dadurch zu seinem Leib gehören (Eph. 1, 10) — war im Garten nur Platz für Adam — aber auch hier für das Weib, solange sie unter seiner Hauptschaft und unter seinem Namen zu seinem Leib gehörte. Ein Name bedeutet im biblischen Sprachgebrauch Wesenhaftigkeit, und indem das Weib infolge der Verfehlung einen eigenen Namen erhält, wird unmißverständlich bestätigt, daß die anfängliche Einheit zwischen dem männlichen und dem weiblichen Teil Adams zerstört ist. Nicht mehr mit einem Wesen haben wir es zu tun, sondern mit zweien, das Weib hat sich individualisiert, aus Adam heraus (und auch von Jahweh) emanzipiert, und die Gerichtsfolgen bestehen unter anderem darin, daß es zur eigenen Persönlichkeit wird. Das Streben Chawahs würde nun zu ihrem Manne hin sein (1. M. 3, 16); auch dies zeigt die Trennung Adams in zwei Persönlichkeiten an, denn solange beide als »Adam m/w« völlig eins waren, konnte und mußte es auch kein Streben zueinander geben. Meine Hand oder mein Auge streben mir schließlich auch nicht zu; sie gehören zu mir, was mit der Zeit eine gewisse Selbstverständlichkeit des gegenseitigen Umganges mit sich bringt. Durch die Verfehlung aber wird das Weib, das schon bei seinem Erschaffen aus Adam heraus abgeteilt worden war (1. M. 2, 21f) erneut von Adam amputiert — diesmal jedoch ohne Narkose und unter Schmerzen, und diese zweite Herausteilung bedeutet nunmehr keine Erweiterung seines Wirkungsbereiches, sondern eine teilweise Rücknahme dieser vorherigen Entfaltung: Chawah würde künftig weitgehend durch ihre individualistische Selbstverwirklichung blockiert und dadurch wenig hilfreich sein. Anfangs kannte Adam sein Weib als »Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch« (1. M. 2, 23), also als natürlichen Bestandteil seiner selbst. Aber nach der Verfehlung lesen wir, daß Adam sein Weib erkannte (1. M. 4, 1) — erkennen kann ich jedoch nur, was mir fremd, was außerhalb von mir selbst ist. Das, was ihm zuvor selbstverständlich bekannt war, war ihm so entfremdet worden, daß er es erst wieder erkennen mußte.
Ein Teil von Gottes Angebot, zu einem schöpfungsgemäßen Sein zurückzukehren, besteht nun darin, daß das Weib in der Ehe dem Manne wieder hinzugefügt werden kann. Die ursprüngliche Einheit ist jetzt aber nicht mehr selbstverständliche Lebenswirklichkeit, sondern wird täglich in Frage gestellt und muß mühsam erworben werden. Die geistliche Wahrheit, die in der ursprünglichen Namensgleichheit der Menschen vorgeschattet ist, bilden dabei selbst bürgerliche Ehen ab, soweit sie mit der Eheschließung der Männin[G] die Ehre zuteil werden lassen, den Namen ihres Mannes zu tragen. Auch der ältere Brauch, eine Frau mit dem Titel ihres Mannes anzureden (z. B. »Frau Professor«, »Frau Studienrat«) stellt — bewußt oder unbewußt — viel geistliche Wahrheit dar. Wer den Namen bzw. Titel eines Hauptes trägt, wird diesem zugerechnet. Das Hebräische stellt diesen Umstand dar, indem es die Braut als כלה (Kalah), als »Alldahinseiende«, also zu existieren aufhörende bezeichnet. Die Braut gibt die Eigenständigkeit, der Adams Weib durch die Verfehlung verfallen ist, und damit auch den eigenen Namen wieder auf und wird durch die Ehe dem Adam wieder hinzugefügt. Nichts anderes wird in Ps. 45, 11 beschrieben, wo die Braut aufgefordert wird, ihr Volk und ihres Vaters Haus zu vergessen — und damit im geistlichen Bereich den gesamten Weg zurückzukehren, den sie seit der Trennung von Adam zurückgelegt hat. Wo sie sich den feministischen Rattenfängern widersetzt, sich darauf einläßt und ihr Selbst verleugnet, kann sie ihre schöpfungsgemäße Würde zurückerlangen.
* Man lasse sich nicht dadurch verwirren, daß hier in 1. M. 5 Geschehnisse berichtet sind, die chronologisch vor denen in 1. M. 3 beschriebenen liegen.
Photo: © Geier